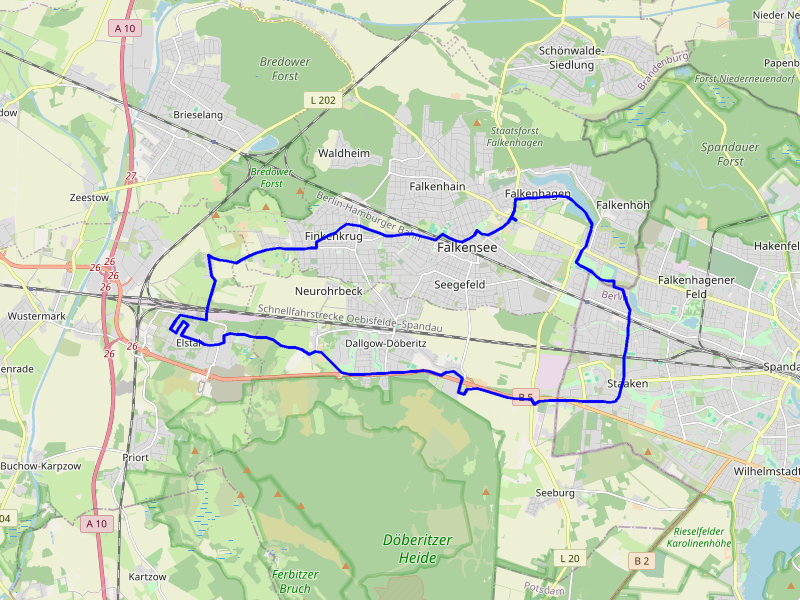Als der Güterverkehr im Westen Berlins um 1900 an seine Grenzen kam, musste die Zugbildung aus der Stadt heraus. Vor den Toren Spandaus entstand der Rangierbahnhof Wustermark – ein neuer Taktgeber der Industrialisierung. Damit die Menschen, die hier Züge zerlegten, neu zusammenstellten und die Technik am Laufen hielten, nicht lange pendeln mussten, plante man nebenan auf dem jungen Gutsbezirk Elstal eine eigene Arbeitersiedlung. Ab 1919 wuchsen die ersten Häuser, 1920 zogen die ersten Familien ein.
Die Eisenbahnersiedlung Elstal folgte der Idee der Gartenstadt: kleinteilige Hausgruppen statt Blocks, ein klar gefasster Mittelpunkt mit Markt, Läden und später Kirche, dazwischen kurze Wege, viel Grün und großzügige Hausgärten zur Selbstversorgung. Bis 1930 standen 86 Häuserblöcke mit 376 Haushalten – eine kleine, in sich funktionierende Stadt, gebaut für die Eisenbahner aller Ränge.
Der Kern bekam früh Ergänzungen: um 1930 der Geschäftsblock am Markt, 1936 die evangelische Kirche, nach dem Krieg 1952 neue Wohnungen an der Karl-Marx-Straße; Schule und Kinderbetreuung stärkten das Quartier. Gleich nebenan schrieb 1934–1936 das Olympische Dorf ein Kapitel Weltgeschichte in die Landschaft – architektonisch anders, zeitgeschichtlich eng verknüpft. So liegt in Elstal die Technik- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts dicht beieinander: der große Bahnhof als Motor, die Siedlung als Zuhause.